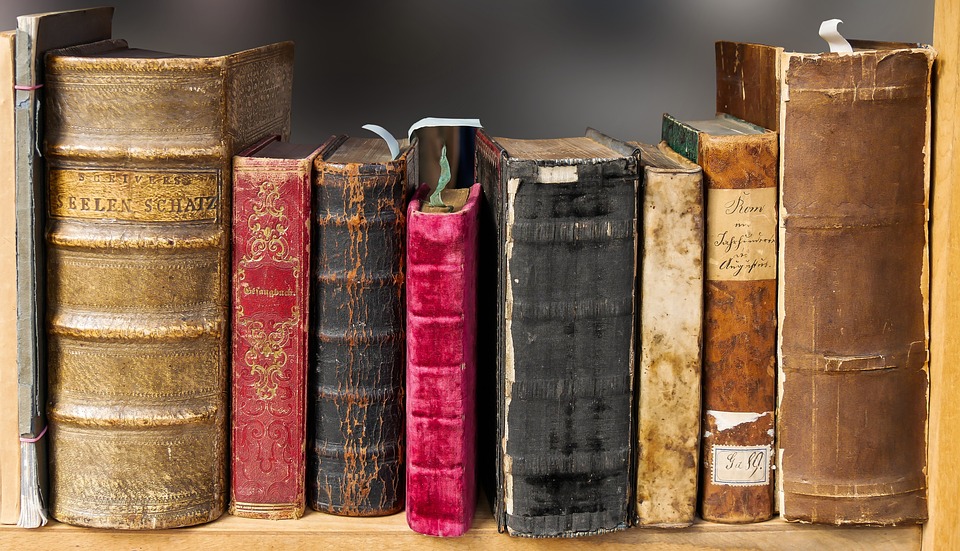Man kann einem Anderen schwerlich die Faszination eines Archivs
nahebringen, wenn er nicht selbst dort gewesen ist, die alten Originale
berührt und den Atem der Geschichte gespürt hat.
Die seltsame Atmosphäre zwischen den Akten und ihren Lesern einzufangen,
ist Arlette Farge in ihrem kleinen Büchlein "Der Geschmack des Archivs"
wunderbar gelungen. Obwohl es nur einen Teil der Wahrnehmungen
einfängt.

Stets sieht man morgens die gleichen, stillen Gesichter. Den Militärhistoriker mit Geheimratsecken, die Doktorandin mit ihrem frischen Schritt auf immer den gleichen Platz, das ältere Paar im Bemühen, gemeinsam leise flüsternd etwas über die Familiengeschichte zu entziffern, der Neuling, der kaum zu atmen wagt und sich vorsichtig mit einer (!) Akte in die letzte Reihe setzt. Man könnte die Reihe fortsetzen.
Es sind teilweise Spitzweg-Figuren, die einem im Archiv begegnen - mich nicht ausgenommen.
Man gewöhnt sich an, denselben Spind zu wählen, den optimalen Platz zu suchen und zu behaupten. Für mich war das immer nah am Lesesaal-Computer, damit ich mal fix was in der Datenbank recherchieren konnte, möglichst mit Platz nach allen Seiten und wenig Ablenkung - bloß keinen Fensterplatz, denn die Verführung, nach draußen zu schauen ist gar zu groß. Ganz zu schweigen von der blendenden Einstrahlung.
Im alten Lesesaal gab es zur "Unterhaltung" von Zeit zu Zeit Geräusche, wenn die hundert Jahre alte Heizung anging und vor sich hin klopfte. Warm wurde einem dennoch nie so richtig. Von Zeit zu Zeit hört man einen schniefen. Im Archiv ist es oft kühl,
und stundenlanges Stillsitzen befördert den "Archivschnupfen". Der ist
keine Einbildung. Ich war jetzt länger nicht dort, und seit meinem
letzten Besuch habe ich ihn verloren.
Überhaupt - der alte Lesesaal! Schon der Eingangsbereich des Archivs war eine Schau. Granitstufen in einer Halle, orangefarbene Metallspinde an der Seite. Nur die Eingeweihten wussten, dass es in der Nähe des Lesesaals noch die alten Holzschränke gab, die natürlich ungleich mehr Aura hatten. Sie waren bei der "Vorzimmerdame", die eine Art Concierge-Dienst verrichtete. Um sie herum vielleicht zehn, und auf der Galerie über ihrem Kopf nochmal soviele Schränke, erreichbar über eine Holzstiege. Die waren immer als erstes belegt. Sogar ältere Herrschaften nahmen die Stufen in Kauf, um an so einen begehrten, historischen Schrank zu kommen. Somit konnte man wählen zwischen einem kleinen Metallschlüssel mit Plastiknummer oder einem schweren Schlüssel mit Holzkugel. Gewissermaßen Schränke zweiter und erster Klasse.
Dann am Empfang links der Eintritt in den Lesesaal. Eine hohe schmale Tür mit geschwungener Klinke, die tief hinunterzudrücken war. Erstaunlich leicht ging die Tür auf, und, war man durch, merkte man, wie schwer es war, sie geräuschlos zu schließen. Im Lesesaal hundert Jahre altes Holzmobilar. Große Eichentische in fünf Reihen mit Platz für 30 Leute. Leichte Holzlehnstühle mit Polsterung. Tische, die was zu erzählen hatten mit ihren Schrammen und tiefen Rillen. Für jeden Arbeitsplatz eine grüne Schreibtischunterlage aus Karton. Was mag nur all für Papier auf diesen Tischen gelegen haben! Wieviele karierte Sakkoärmel mit Ellenbogenschonern mögen auf diesen Tischen gelegen haben.... Man musste unter den Tisch kriechen, wenn man zur Steckdose wollte. Aber das war erst gegen Ende nötig, denn zuvor war das Abschreiben der Akten Usus, und man hörte statt des Klack-klack-klack der Tastatur ein vielfaches Rutschen von Bleistiften (!) - Geräusche wie in einer Klassenarbeit. Als die Laptops Einzug ins Archiv hielten, kam das einer Revolution gleich. Morgens hörte man mindestens einmal die Startmelodie eines Computer, spätnachmittags ebenso oft die Melodie, mit der die Laptops schlafen gingen. Dazwischen nur: klack-klack-klack. Schweres Atmen älterer Herrschaften. Hin und wieder ein Durchatmen oder Räuspern. Oder ein halbfreudiges "aha!", das dem Papier sagen sollte: "Jetzt hab ich dich!" Manchmal Selbstgespräche. Sehr viel gaben die Leser nicht von sich preis. Da war das Mobilar schon gesprächiger. Eine gelegentlich knarrende Wendeltreppe zu den Nachschlagewerken in der Galerie. Stühle, die vorwurfsvoll auf dem Linoleumboden gräßliche Geräusche machten, wenn man es sich bequem zu machen versuchte. Ein krachendes Geräusch, wenn jemand die immer klemmenden Stecker aus der Steckdose zerrte. Die Aufsicht saß an den zwei Enden des Raumes auf erhöhten Podestarbeitsplätzen. Grün/goldene, rundliche Tischlampen mit kleinen hängenden Stricken zum Anschalten. Sie gaben eine, ich will mal sagen: sparsame Beleuchtung. Doppelfenster mit dem dichten Blätterdach der kleingestutzten Bäume davor. Sie rauschten, wenn die Fenster im Sommer offen standen.
Dazu hörte man die Eingangstür zigmal am Tag schwer ins Schloss fallen. Unwillkürlich die
Frage: Was wollen die bloß immer, die dauernd rein und raus gehen? Klar
- alte Leute müssen mal. Immer öfter. Zwischen Metallspinden und Empfangsdame der Flur mit den Toiletten war ihr Ziel. Die Toilette mit dem Sprung in der Fliese am Waschbecken und
dem kleinen Fensterchen...Im Flur gab es auch eine Sitznische mit
dunkelhölzerner Eckbank. Wie oft habe ich dort in
der Ecke, meine Schnitten kauend, zur Mittagspause ein Dossier der ZEIT gelesen! Und wie hab ich mich geärgert, wenn der Platz schon vergeben
war. Dann hieß es: rausgehen, denn einen Pausenraum gab es nicht.
Stattdessen aß ich mein Brot ein paar Minuten entfernt, auf einer Bank
beim Bogenschützen mit Blick auf die Elbe. Auch nicht der schlechteste
Platz. Dann wieder zurück ins Archiv. Das rechte Fenster offen - die rechte Aufsicht macht auch gerade Pause. Oder das linke Fenster offen - die linke Aufsicht hat Pause. Hinsetzen, weitermachen, nur unterbrochen vom Lauschen auf Gespräche, denn das leise Sprechen der Aufsicht konnte man nicht ausblenden, wenn neue Leser das Prozedere erklärt bekamen. Und vom Nachbarraum hörte man das Hin- und Herspulen der Rollfilme. Die Arbeit an den Lesegeräten ist ungesund, weil man entweder einen steifen Hals bekommt oder einem schwindlig wird (oder beides). Zugleich dauerte die Lektüre ungleich länger, weil auf den Filmen stets mehr war, als man eigentlich brauchte. Kaum war das umständliche Einfummeln des Filmstreifens geschafft, begann bei den ersten Bildern stets dasselbe: Man schaute hin, obwohl auf der Schachtel unmißverständlich stand, dass der gewünschte Abschnitt erst gegen Ende des Films zu erwarten war. Eigentlich könnte man gleich weit vorspulen. Aber der Lärm des Spulens ist ja so laut! Und es ist eine Verführung, zu sehen, was außer der eigentlich bestellten Akte noch so auf dem Film ist. Wer könnte da widerstehen, wenn man die Akte mit der anderen Strichnummer doch schon mal vor sich hat! Ein Blick kann ja nicht schaden, worum es darin geht... "Ach, das ist ja interessant..." Eine halbe Stunde später stellt man fest, dass man gar nicht das liest, was man eigentlich sollte. Und der Blick auf die Uhr sagt einem, dass man das angestrebte Ziel heute wohl nicht mehr schaffen kann.
Im neuen Lesesaal ist es grau/weiß. Zwei Steckdosen in jedem Tisch leicht erreichbar. Moderne, kantige Metalllampen, die ein sehr gutes Lesen ermöglichen. Saubere, aalglatte Tischoberflächen. Glastüren, die mit einem lauten Klacken von selbst aufspringen. Die Aufsicht, die in das hohe, lichte Foyer hinter einen Tresen verbannt wurde. Bahnhofsatmosphäre. Aber immerhin ein heller Raum, wo das Personal nun in normaler Gesprächslautstärke die Leser beraten kann und sowohl die Leser im Lesesaal als auch die Leser im Filmlesesaal im Blick haben, die jetzt ihren Krach in einem eigenen Raum austoben dürfen.
Nur eines ist gleich geblieben: die charmante Art der Aufsicht, fünf Minuten vor Schließung mit einem Glöckchen die Leser an das Ende des Arbeitstages zu erinnern. Und wie dann alle emsig ihre Siebensachen zusammenpacken. Bloß nicht zu langsam sein, damit man nicht anstehen muß. Aber man muss es wahrscheinlich trotzdem. "Das hier noch liegen lassen. Das andere brauch' ich nicht mehr." So oder so ähnlich geht es. Damals wie heute. Dann verschwinden die stillen, grauen Gestalten hinaus ins Licht, ins Leben. Zu den angeschlossenen Fahrrädern, den Autos in der Nebenstraße der "Archivstraße".

Und zusammen mit dieser Atmosphäre verknüpft sind die Gefühle bei echten Entdeckungen. "Yes!", denkt man. Oder das Gefühl der Enttäuschung, wenn statt einer dicken, fetten Akte, nur ein paar Blättchen in einem Umschlag liegen. Als wäre Weihnachten ausgefallen. Oder das Gefühl, wenn man stutzig wird. Wenn man den Brief nochmal von vorn beginnen muss: "Irgendwo hier muss doch stehen, worauf der sich bezieht...?" Oder das Gefühl, das man spürt, wenn man Originale berühmter Leute in der Hand hält. Ehrfurcht: Das ist eine Urkunde von Barbarossa. Das ein Brief von Luther. Das eine Unterschrift von Bach. Unvergessen, wie ich die Handschrift von August dem Starken nur verstehen konnte, wenn ich sie mir leise selbst vorlas, denn er war Legastheniker und schrieb dermaßen sächsisch, und noch dazu sehr unleserlich, dass man eher von einer Lautschrift als von einer Handschrift sprechen kann. Und der innere Jubel, als ich seine Geheimschrift entschlüsselte. Aber das ist eine andere Geschichte.
So ist das Archivleben - zumindest habe ich es so erlebt. Ich liebe es, seit 2002.