Wackerbarth klagt nicht mehr aus Wien, sondern ist, wir schreiben das Jahr 1704, inzwischen an die Front des Spanischen Erbfolgekrieges nach Landau gezogen. Er begegnet dem Herzog von Marlborough, der den Oberbefehl über die Unionstruppen führt und den er stets nur "Milord Duc" benennt. Kurz und dennoch vielsagend lässt er Flemming wissen, dass Milord vor der Eroberung von Landau das Lager verlassen hat: "il pourroit mieux emplojer ce tems ailleurs" (er kann seine Zeit woandern besser verwenden). Ist das neutral oder sarkastisch gemeint? Er verkneift sich jeden Kommentar, aber schreibt ein paar Zeilen später: "Voila mon cher frere ce qui engage Milord a quiter cet armée, avant que Landau soit pris." (Bitte sehr, mein teurer Bruder, das ist es, warum Milord die Armee verlässt, bevor Landau eingenommen ist). Flemming darf sich seinen Teil dazu denken.
Dem Brief beigefügt hat er die offizielle Bericht an den König. Dort heißt es ausführlicher - übrigens nicht in Französisch, sondern auf Deutsch! - "Nachdem sich die hiesige Belagerung weiter hinan ziehet, als man vermuthet, herentgegen der Winter mit dem Schlamm und Wetter herannahet und sdie sehr Strappezierte Armee insonderheit ruinirte Cavallerie zeitluse Veranstaltung ihres retablissements erheischet, damit selbige künfftige Campagne früher denn der Feind ins Feld seyn und solcher Gestalt denen ietzigen Progressen favorable suiten versprechen könne, so hat man im letzten Kriegsrath vor diensamer ermeßen, daß der Myl. Marleborogk die Zeit allheir nicht mit Erwartung der Übergabe von Landau verliehre, sondern zu Veranstaltung des benöthigten seine Abreyße antrete..."
Dem König gegenüber wird also eine etwas andere Nuance betont und der Entscheid des Herzogs von Marlborough nicht in Zweifel gezogen, sondern präzise erklärt. Flemming gegenüber scheint mir hinter dem "Voilà" indes ein gewisser Unmut zu lauern. Immerhin wird diese Formulierung nur verwendet, um auf etwas Außergewöhnliches hinzuweisen. Man kann es auch übersetzen mit "Na bitte... da haben wir's...großartig, nicht wahr?" Marlborough lässt die anderen die Drecksarbeit machen und macht sich buchstäblich vom Acker, um sich um wichtigere Dinge zu kümmern. Von großer Wertschätzung und Nähe ist keine Rede. Auch in den nächsten Zeilen steht nichts davon, dass dieser Milord besonders freundlich ist - im Gegenteil. Offenbar war Marlborough eine Diva mit Cowboy-Allüren.
Wackerbarth gibt seinem Freund noch einige Tipps für die Unterredung mit Marlborough in Berlin: Es sei nötig, alle Formalitäten und Geschwätz wegzulassen, und Flemming soll ihm ein Faß Tokajer schenken, aber "Il faut que le vins soit doux." (Der Wein muss süß sein!)
Auch über die Kommunikationswege erfährt man einiges: Wackerbarth deutet vieles an, schreibt häufig, er werde alles Nötige mündlich mitteilen. Er bedauert, nicht an seine Chiffre zu kommen. Die Bedeutung der Geheimhaltung war ihm also voll bewusst. Für die Durchreise von Landau nach Wien wird ein Treffen in Sachsen organisiert: "Ist es für Sie zu weit, nach Leipzig zu kommen, oder wäre es bequemer, bis nach Wittenberg zu kommen? Bitte geben Sie Rückmeldung, damit ich mich danach richten kann. Ich werde Ihnen aus Frankfurt einen Boten schicken, der Sie informiert, wann ich an einem der beiden Orte sein kann."
Manchmal bemerkt er, dass er lange nichts von Flemming gehört hat, und beim zweiten Mal klingt das dann schon etwas fordernd: "Ich habe seit Leipzig keine Neuigkeiten von Ihnen erhalten, obwohl ich Ihnen keine einzige Gelegenheit ausgelassen habe, mich bei Ihnen zu erkundigen, wie es Ihnen geht."
Oft wird in großer Hast geschrieben, und Wackerbarth muss sich immer wieder um Verzeihung bitten: "Entschuldigen Sie das Durcheinander in diesem Brief sowie die Fehler. Ich musste sehr schnell schreiben, um die Post nicht zu verpassen." Selbst in dem Bericht an den König erlaubt er sich diese Entschuldigung am Schluss: "Sollte sich demnach hierinnen einige Confusion eingeschlichen haben, so werden E. K. M. der allzugroß Eilfertigkeit dero man sich in diesem Fall bedienen mußen beyzulegen allergn. geruhen"
Trotz aller Eile werden die Formalitäten weitestgehend gewahrt. An Flemming lautet die stets gleiche Anrede: "Monsieur tres honore frere" bedeutet keine verwandtschaftliche Beziehung, sondern dass sich beide in Gleichrangigkeit befanden, wie wir aus dem Staatstitularbuch erfahren. Die immergleiche Schlussformel lautete: "Mit unerschütterlicher Verbundenheit bin ich, Monsieur, Euer Exzellenz hochverehrter Bruder und sehr untertäniger und gehorsamer Diener AC de Wackerbarth"
Die Briefe zeugen von einer wirklich guten Beziehung beider. Sonst hätte Wackerbarth niemals so offen kommuniziert. Wie sehr er Flemming schätzt, wird auch deutlich, als er einige Zeit keine Schreiben von ihm erhält:
"Ich habe Schwierigkeiten einen Grund für Euer Schweigen zu finden, denn ich erhalte seit einiger Zeit keine einzige Silbe mehr von Euch, obwohl Ihr mich früher nie ohne Nachrichten gelassen habt. Um mich auf irgendeine Weise zu trösten, stelle ich mir vor, dass Ihr solche Zeit mit meinen Angelegenheiten verbringt, anstatt mir zu schreiben, und dass eine so aufmerksame Hingabe nur ein glückliches Ergebnis für mich verspricht. Ich hege meine Sehnsucht nach Euch wie die zärtlichsten Liebhaber ihre Geliebten. Ich bin beunruhigt, wenn sie mir die Zeichen ihrer Erinnerungen verwehren, und so sieht es aus, wenn man einmal überzeugt ist, wie Ihr es getan habt. Ihr habt es geschafft, mein lieber Bruder, einer meiner Freunde zu sein."
Als dann endlich wieder Post eintrifft, seufzt Wackerbarth erleichtert: "Die Teilnahme, die Sie an allem zeigen, was mich betrifft, mit großer
Dankbarkeit aufnehme, denn Sie sind der beste Fürsprecher, den ich mir
wünschen könnte."
Selbst delikate Angelegenheiten kann Wackerbarth Flemming anvertrauen, so seine Unsicherheit:
"Ihr werdet besser als ich beurteilen können, ob die Angelegenheit vorangeht oder scheitert, wenn mein Name in der Sache genannt wird. Ich persönlich denke, es wäre besser, ihn nicht zu nennen. Aber Ihr, mein lieber Bruder, werdet tun, was Ihr für richtig haltet, denn ich bin überzeugt von Eurem Eifer, Eurem Verstand und der Geschicklichkeit, mit der Ihr die Dinge anpackt, sodass ich keine Angst haben muss, für die 10.000 Escus ausgenutzt zu werden (Ihr versteht mich richtig)."
Er stellte seine Person demnach hinter die Sache und wusste sich zurückzunehmen. Aber ob das immer der Fall war, werden wir sehen.









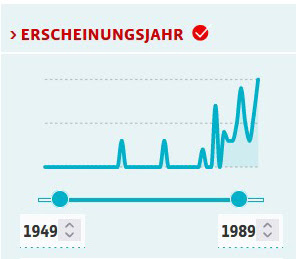





,_RP-P-2016-1197.jpg)
